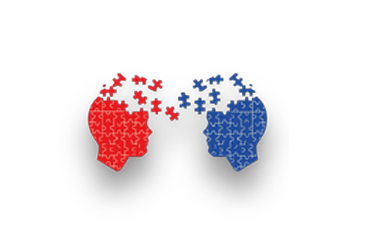ELEKTROKURSE.de
- Schulungen
- Seminare und
- Ausbildungen für
- Online
- Inhouse und
NEU!! Präsenzveranstaltungen in 16816 Neuruppin
20 % Rabatt
Auf jede Kursanmeldung.Rabattcode: EK2024


Die Unternehmerverantwortung für die Elektrosicherheit
1. Wer ist „Arbeitgeber“?
Arbeitgeber ist jeder, der Arbeitnehmer beschäftigt.
Im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes fallen unter den Begriff „Arbeitgeber“
⇒ siehe Katalog – Arbeitsschutzgesetz
natürliche und juristische Personen sowie
rechtsfähige Personengesellschaften, die neben Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern auch Auszubildende oder arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des
§ 5 Abs. 1 des Arbeitsschutzgesetzes, ausgenommen die in Heimarbeit Beschäftigten und
die ihnen Gleichgestellten, beschäftigen.
Zu den Beschäftigten zählen auch Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter,
Soldatinnen und Soldaten sowie in Werkstätten für Behinderte beschäftigte Personen.
2. Wer ist „Unternehmer“?
Arbeitgeber ist jeder, der Arbeitnehmer beschäftigt.
In der früheren für den öffentlichen Dienst geltenden Unfallverhütungsvorschrift
GUV‐V A1 „Allgemeine Vorschriften“ war der Unternehmerbegriff wie folgt definiert:
„Unternehmer sind die Gemeinden und Gemeindeverbände,
die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, das Bundeseisenbahnvermögen sowie
die weiteren Mitgliedsunternehmen der Eisenbahn‐Unfallkasse (EUK),
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie
sonstige natürliche und juristische Personen,
die Mitglied des Unfallversicherungsträgers sind.“
[Anmerkung: Zu letzterem zählen z. B. auch Privatpersonen,
die eine Haushaltshilfe beschäftigen].
3. Worin liegt der Unterschied zwischen „Arbeitgeber“ und „Unternehmer“
Staatliche Arbeitsschutzvorschriften gelten –
sofern in ihrem Geltungsbereich nichts anderes beschrieben wird –
z. B. nicht für Schülerinnen und Schüler oder
für Kinder, die Kindertageseinrichtungen besuchen.
Da aber insbesondere Schulkinder und Kindergartenkinder sowie
ehrenamtlich Tätige unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen und
somit die Verpflichtung besteht, Kinder vor Unfällen und Krankheiten zu schützen,
wurde in den Unfallverhütungsvorschriften der Unternehmerbegriff eingeführt.
Unter diesen fallen deshalb u.a. auch Schulleitungen sowie
Leitungen von Kindertageseinrichtungen.
Die DGUV‐Vorschrift 1 eröffnet den Unfallversicherungsträgern durch
§ 2 Abs. 1 die Möglichkeit, sich auch auf staatliche Rechtsvorschriften berufen zu können.
Über diesen „Kunstgriff“ können somit staatliche Arbeitsschutzvorschriften auch
für solche Versicherten Anwendung finden,
die ansonsten nicht von deren Geltungsbereich erfasst werden.
Weiterhin gilt auch folgende Unterscheidung zwischen
„Arbeitgeber“ und „Unternehmer“:
Ein Selbstständiger, der keine weiteren Personen beschäftigt,
ist zwar Unternehmer, jedoch kein Arbeitgeber.
Im Gegenzug ist eine Privatperson, die eine Haushaltshilfe beschäftigt,
zwar Arbeitgeber, nicht jedoch auch zwangsläufig Unternehmer.
In Bezug auf die hier betrachteten arbeitsschutzrechtlichen Fragestellungen
bestehen ansonsten keine wesentlichen Unterschiede.
⇒ siehe Katalog – DGUV Vorschrift 1
4. Wer ist neben dem Arbeitgeber sonst noch für den Arbeits‐ und Gesundheitsschutz verantwortlich?
Verantwortlich für die Erfüllung der sich aus[Abschnitt 2 des Arbeitsschutzgesetzes] ergebenden Pflichten sind neben dem Arbeitgeber
⇒ siehe Katalog
- sein gesetzlicher Vertreter,
- das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen Person,
- der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft,
- Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens oder
eines Betriebes beauftragt sind,
im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben und Befugnisse, - sonstige nach Abs. 2 oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnung oder nach einer Unfallverhütungsvorschrift
verpflichtete Personen im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse.
(Quelle: Arbeitsschutzgesetz, § 13)
5. Was umfasst den Begriff „Unternehmerverantwortung“ in Bezug auf den Arbeits‐ und Gesundheitsschutz?
In Deutschland ergibt sich für jeden Arbeitgeber bereits aus der allgemeinen Fürsorgepflicht(§§ 617 – 619 BGB) die Aufgabe, Beschäftigte und sonstige Personen vor Gefahren
für Leib und Leben zu schützen.
Konkretisiert wird diese Verpflichtung durch weitergehende Gesetze und
Verordnungen (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitsstättenverordnung)
⇒ siehe Katalog – Arbeitsschutzgesetz
⇒ siehe Katalog – Betriebssicherheitsverordnung
sowie durch Unfallverhütungsvorschriften.
Diese Verpflichtung obliegt jedoch nicht nur dem Arbeitgeber allein,
sondern auch jedem sonstigen weisungsbefugten Beschäftigten.
Grob lässt sich die Unternehmerverantwortung in drei große Teilbereiche untergliedern:
1) Organisationsverantwortung:
Der Arbeitgeber ist verpflichtet,
die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen,
die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben.
Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Abs. 1 hat der Arbeitgeber
unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten
für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen
sowie Vorkehrungen zu treffen, damit die Maßnahmen erforderlichenfalls
bei allen Tätigkeiten und eingebunden in die betrieblichen Führungsstrukturen beachtet werden und
die Beschäftigten ihren Mitwirkungspflichten nachkommen können.
(Arbeitsschutzgesetz, § 3, Abs. 1 und 2)
2) Auswahlverantwortung:
Ein Unternehmer kann in der Regel nicht über eine für die Beantwortung aller
in seinem Unternehmen auftretenden sicherheitstechnischen Fragestellungen Qualifikation verfügen.
Deshalb regelt das Arbeitsschutzgesetz, dass bei der Übertragung von Aufgaben
auf Beschäftigte der Arbeitgeber je nach Art der Tätigkeiten zu berücksichtigen hat,
ob die Beschäftigten auch befähigt sind,
die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfüllung
zu beachtenden Bestimmungen und Maßnahmen einzuhalten (Arbeitsschutzgesetz, § 7).
Präzisiert wird diese Anforderung noch durch § 13 des Arbeitsschutzgesetzes:
„Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen
schriftlich damit beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz
in eigener Verantwortung wahrzunehmen.“
3) Aufsichtsverantwortung:
Die Übertragung von Aufgaben entbindet den Unternehmer nicht
von seiner Gesamtverantwortung.
Die Pflicht zur Überwachung ergibt sich u.a. aus
§ 3 des Arbeitsschutzgesetzes:
„Er [der Arbeitgeber] hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und
erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen.
Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und
Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben.“
Die sonstigen Aufgaben und Verantwortungsbereiche
(Pflicht zur Unterweisung, Koordination von Fremdfirmeneinsätzen etc.)
ergeben sich aus diesen drei Hauptverantwortungen.
6. Welche Pflichten sind beim Ersatz von Fremdfirmenmitarbeitern zu beachten, die in einem Unternehmen die Prüfung elektrischer Betriebsmittel vornehmen?
Die Arbeitsschutzpflichten beim Einsatz von Fremdfirmenmitarbeitern regeln u. a.§ 8 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz und § 13 Betriebssicherheitsverordnung.
⇒ siehe Katalog – Arbeitsschutzgesetz
⇒ siehe Katalog – Betriebssicherheitsverordnung
Demnach haben Arbeitgeber sich je nach Art der Tätigkeit dahingehend zu vergewissern,
dass die Beschäftigten anderer Arbeitgeber, die in ihrem Betrieb tätig sind,
angemessene Anweisungen hinsichtlich der Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit
während ihrer Tätigkeit in ihrem Betrieb erhalten haben.
Zusätzlich regelt § 5 Abs. 3 DGUV Vorschrift 1,
⇒ siehe Katalog – DGUV Vorschrift 1
dass der den Auftrag erteilende Unternehmer den Fremdunternehmer
bei der Gefährdungsbeurteilung zu unterstützen hat.
Dies betrifft vor allem die betriebsspezifischen Gefahren,
die bei der Ausführung der Prüftätigkeit auftreten können.
Zudem muss jeder auftragserteilende Unternehmer sicherstellen, dass
Tätigkeiten mit besonderen Gefahren durch einen Aufsichtführenden überwacht werden und
somit die Durchführung der festgelegten Schutzmaßnahmen sichergestellt wird.
Der Unternehmer hat mit dem Fremdunternehmen einvernehmlich zu klären,
wer den Aufsichtführenden stellt.
7. Ist der Arbeitgeber verpflichtet, seine Elektrofachkräfte regelmäßig weiterbilden zu lassen?
Generell ist in Bezug auf die Weiterbildung von Elektrofachkräften§ 7 des Arbeitsschutzgesetzes zu beachten.
Dieser verpflichtet den Arbeitgeber,
für die Übertragung von Aufgaben auf Beschäftigte nur Mitarbeiter auszuwählen,
die fachlich und persönlich zur Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben geeignet sind.
Hierzu gehört auch die Kenntnis des aktuellen Standes des dazu benötigten Fachwissens.
Feste Fristen für die Aktualisierung des Fachwissens gibt der Gesetzgeber nicht vor.
In Bezug auf Elektrofachkräfte, welche Prüfungen gem. BetrSichV als
befähigte Personen durchführen, regelt § 2 Abs. 6 BetrSichV, dass
diese Personen für ihre Tätigkeiten über Fachkenntnisse verfügen müssen,
die sie durch eine für die vorgesehene Prüfaufgabe adäquate technische Berufsausbildung,
eine mindestens einjährige praktische Berufserfahrung und
eine zeitnahe, im Zusammenhang mit der Durchführung von Prüfungen stehende berufliche Tätigkeit erworben haben.
Die Mindestvoraussetzungen für die Erfüllung dieser Kriterien sind in der
Technischen Regel für Betriebssicherheit (TRBS) 1203 „Zur Prüfung befähigte Personen“ beschrieben.
Für die zeitnahe berufliche Praxis,
eine der genannten Grundvoraussetzungen für den Erwerb der Qualifikation als zur
Prüfung befähigte Person, regelt die TRBS 1203 u. a.:
⇒ siehe Katalog – TRBS 1203
- in Abschnitt 3.1 Abs. 4, dass die zur Prüfung befähigte Person
für die Prüfungen der Maßnahmen zum Schutz vor elektrischen Gefährdungen ihre
Kenntnisse der Elektrotechnik regelmäßig aktualisieren muss
(z. B. durch Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Unterweisungen und
am einschlägigen Erfahrungsaustausch) - in Abschnitt 2.4 Abs. 1,
dass zum Erhalt der Prüfpraxis bei längeren Unterbrechungen der Prüftätigkeit
erneut Erfahrungen mit Prüfungen zu sammeln und
die notwendigen fachlichen Kenntnisse zu aktualisieren sind.
Nähere Informationen über die weiteren Voraussetzungen
für die Befähigung finden Sie hier:
„TRBS 1203 – Zur Prüfung befähigte Personen“
8. Welche Pflichten hat ein Unternehmer in Bezug auf die Prüfung der von Fremdfirmen genutzten Arbeitsmittel?
Gemäß Arbeitsschutzgesetz und Betriebssicherheitsverordnung⇒ siehe Katalog – Arbeitsschutzgesetz
⇒ siehe Katalog -Betriebssicherheitsverordnung
trägt jeder Arbeitgeber, der seinen Beschäftigten Arbeitsmittel zur Verfügung stellt,
die Verantwortung dafür,
dass diese den arbeitsschutz‐ und sicherheitstechnischen Anforderungen in Bezug auf den
erforderlichen Sicherheits‐ und Gesundheitsschutz entsprechen.
Nicht nur dem Auftragnehmer, sondern auch dem Auftraggeber
obliegen beim Fremdfirmeneinsatz sowohl auf Grundlage des staatlichen Arbeitsschutzrechtes
(ArbSchG, BetrSichV) als auch auf Grundlage der
DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ Arbeitsschutzpflichten.
⇒ siehe Katalog – DGUV Vorschrift 1
Gemäß § 5 Abs. 3 der DGUV Vorschrift 1 hat der den Auftrag erteilende Unternehmer das
Fremdunternehmen bei der Gefährdungsbeurteilung bezüglich
der betriebsspezifischen Gefahren zu unterstützen und sicherzustellen, dass
Tätigkeiten mit besonderen Gefahren durch Aufsichtführende überwacht werden.
Der Unternehmer hat mit dem Fremdunternehmen Einvernehmen herzustellen,
wer den Aufsichtführenden stellt.
Gemäß § 8 Abs. 2 ArbSchG muss der Arbeitgeber sich je nach Art der Tätigkeit vergewissern,
„dass die Beschäftigten anderer Arbeitgeber, die in seinem Betrieb tätig werden,
hinsichtlich der Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit während ihrer Tätigkeit
in seinem Betrieb angemessene Anweisungen erhalten haben.“
Um feststellen zu können, inwieweit eingesetzte Arbeitsmittel von
Fremdunternehmen regelmäßig, hinreichend und normgerecht geprüft wurden,
müsste zusätzlich zur Prüfdokumentation die entsprechende Gefährdungsbeurteilung
zur Ermittlung von Art, Umfang und Fristen vom Auftragnehmer eingefordert und
gesichtet werden – eine Lösung, die in der Praxis ohne
die zusätzliche Hinzuziehung weiterer Fachleute nur schwer durchführbar wäre.

Betriebliche Organisation und Beauftragung im elektrotechnischen Betriebsteil
1. Welche Formen betrieblicher Beauftragungen gibt es?
Aufgaben können in den nachfolgenden Formen übertragen werden
- per Arbeitsvertrag
- per Stellenbeschreibung
- per Organisationsverfügung
- per Beauftragung im Einzelfall
eines neuen Mitarbeiters die Möglichkeit, Aufgaben und Befugnisse
eindeutig zuzuweisen.
Mit steigender Komplexität der Aufgaben bzw.
steigender Verantwortung wird jedoch in der Regel zunächst
eine gewisse Einarbeitungszeit verstreichen müssen,
bevor ein neuer Mitarbeiter mit
anspruchsvolleren Aufgaben beauftragt werden kann.
In diesem Fall können die per Arbeitsvertrag oder
Stellenbeschreibung bereits grundsätzlich festgelegten Aufgaben
durch eine Organisationsverfügung
(z. B. Änderung des Betriebsorganigramms,
Einsetzung/Änderung bestehender betrieblicher Organisationseinheiten etc.)
zu dem gewünschten Zeitpunkt in Kraft treten.
Beauftragungen im Einzelfall stellen einen weit verbreiteten Weg dar,
um z. B. kurzfristig auf Änderungen im Vorschriften‐ und
Regelwerk reagieren zu können
(z. B. Bestellung von Brandschutzhelfern aufgrund der
Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR 2.2).
Weitere Informationen sind in Kapitel 2.12
„Pflichtenübertragung“ der DGUV Regel 100‐001
„Grundsätze der Prävention“ sowie in der DGUV Information 211‐001
„Übertragung von Unternehmerpflichten“ enthalten.
2. In welcher Form muss eine Pflichtübertragung erfolgen?
Betriebliche Beauftragungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.
Sie müssen konkret den Wunsch des Beauftragenden zum Ausdruck bringen,
dass nachgeordnete Fach‐ bzw. Führungskräfte bestimmte Aufgaben
in ihrer eigenen Verantwortung ausführen sollen.
Dies macht es notwendig, diese Aufgaben sowie die für die
selbstständige Durchführung notwendigen Mittel
(Rechte, Befugnisse, Kompetenzen etc.) genau zu beschreiben und
gegenüber anderen Verantwortungsbereichen abzugrenzen.
Die Beauftragung ist von dem zu Beauftragenden zu unterzeichnen.
Eine Kopie der Beauftragung ist dem Beauftragten auszuhändigen.
Eine Beauftragung sollte auch eine Aufklärung über
mögliche rechtliche Konsequenzen bei Verstößen beinhalten.
Ein Muster für eine Beauftragung ist in Kapitel 2.12
„Pflichtenübertragung“ der DGUV Regel 100‐001
„Grundsätze der Prävention“ enthalten.
DGUV Regel 100-001 als Katalog betrachten.
3. Was ist bei der Pflichtübertragung zu beachten?
„Bei der Übertragung von Aufgaben auf Beschäftigte hat der Arbeitgeber
je nach Art der Tätigkeiten zu berücksichtigen,
ob die Beschäftigten befähigt sind,
die für die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz bei der
Aufgabenerfüllung zu beachtenden Bestimmungen und
Maßnahmen einzuhalten.“
(§ 7 Arbeitsschutzgesetz).
⇒ siehe Katalog
Pflichten dürfen deshalb nur auf solche Personen übertragen werden,
von denen man ausgehen kann, dass sie die übertragenen Pflichten auch
in eigener Verantwortung wahrnehmen können.
Dies bedeutet insbesondere, dass diese Personen zuverlässig und
fachkundig sein sowie die für die Durchführung der Aufgaben notwendigen
körperlichgeistigen
Voraussetzungen erfüllen müssen.
Wie diese Anforderungen konkret umzusetzen sind,
ist individuell in jedem Einzelfall zu prüfen.
Ein Unternehmer darf nämlich Versicherte,
die erkennbar nicht in der Lage sind, eine Arbeit ohne
Gefahr für sich oder andere auszuführen,
mit dieser Arbeit nicht beschäftigen.
Bei der Übertragung von Aufgaben ist weiterhin zu berücksichtigen,
dass diese sozialadäquat erfolgt.
Damit ist insbesondere gemeint, dass
- übertragene Aufgaben und Verantwortungen zu der Position des Beauftragten passen,
- der Arbeitsumfang von der beauftragen Person umsetzbar sein muss,
- die fachlichen Voraussetzungen (Erfahrungen, Kenntnisse) für die übertragenen Aufgabe vorliegen,
4. Haftet man auch,
wenn zwar keine schriftliche Aufgabenübertragung erfolgt ist,
man jedoch die Aufgaben tatsächlich wahrnimmt?
Die betriebliche Praxis zeigt,
dass in sehr vielen Fällen Aufgaben nur mündlich übertragen
werden.
Erklärt sich der Beauftragte damit einverstanden bzw.
führt er die Aufgaben tatsächlich aus, kann auch ohne
schriftliche Aufgabenübertragung gegebenenfalls der Begriff
der
„faktischen Übernahme“ der Unternehmerverantwortung zur Anwendung kommen.
Der Beauftragende mag zwar die Aufgaben nicht gesetzeskonform
(wegen der Nichtwahrung der Schriftform) übertragen haben,
jedoch kann er – sofern der Beauftragte nicht nachweislich
seine Einwände bzw. seinen Widerspruch
bei einer mündlich durchgeführten Beauftragung vorgebracht hat –
von der Vermutung ausgehen,
dass der Beauftragte seinen neuen Aufgaben nachkommen wird.
5. Kann ein Unternehmer trotz erfolgter Aufgabenübertragung
auf eine nachrangige
Führungskraft zur Verantwortung gezogen werden,
wenn diese ihre Aufgaben nicht
ordnungsgemäß erfüllt?
Verschiedene Gerichtsurteile belegen,
dass Unternehmer und Führungskräfte auch trotz
erfolgter Aufgabenübertragung belangt werden können,
z. B. wenn sie ihrer Aufsichtspflicht oder
ihrer Organisationsverantwortung nicht ordnungsgemäß nachgekommen sind.
Beispiel:
Zwei auf einer ungenügend gesicherten Baustelle spielende Kinder
wurden von einer umstürzenden Mauer erfasst und
verunglückten dabei tödlich.
Die Staatsanwaltschaft ermittelte in diesem Fall nicht nur gegen den Bauleiter,
der für die Sicherung der Baustelle unmittelbar verantwortlich war,
sondern auch gegen den Leiter des städtischen Bauamtes
(weil dieser den Bauleiter und die Einrichtung der Baustelle
hätte überwachen müssen) sowie gegen den Bürgermeister
(weil dieser für die Organisationsmängel innerhalb des
Bauamtes verantwortlich gemacht wurde,
die er bei ordnungsgemäßer Überwachung hätte feststellen können).
6. Kann ein Beschäftigter auch dann haftbar gemacht werden,
wenn er Mängel oder
betriebliche Defizite,
die seinen Kompetenzbereich überschreiten, zwar gemeldet
hat,
die vorgesetzte Stelle jedoch nicht reagiert?
Natürlich müssen zur Klärung dieser Frage alle jeweils
gegebenen Rahmenbedingungen in Betracht gezogen werden,
doch grundsätzlich ist die Frage mit „Ja“ zu beantworten,
was nachfolgend anhand eines Fallbeispiels verdeutlicht werden soll:
Eine Elektrofachkraft wurde mit der Leitungs‐ und Aufsichtsführung
gegenüber einer elektrotechnisch unterwiesenen Person beauftragt.
Die für die Durchführung der vorgesehenen Aufgaben erforderlichen Werkzeuge
(alternativ: PSA)
wird von dem Arbeitgeber nicht zur Verfügung gestellt.
Die Elektrofachkraft verfügt jedoch selbst nicht über die Mittel,
um diese in eigener Verantwortung beschaffen zu können.
Gemäß den Durchführungsanweisungen zu § 3 Abs. 1 der
Unfallverhütungsvorschrift 3 bzw. 4 hat die
⇒ siehe Katalog
Elektrofachkraft im Rahmen ihrer Leitungs‐ und Aufsichtsführung dafür zu sorgen,
dass Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln von Personen,
die nicht die Kenntnisse und Erfahrungen einer Elektrofachkraft haben,
sachgerecht und sicher durchgeführt werden können.
Die Elektrofachkraft hat also gegenüber der ihr unterstellten
elektrotechnischen Person insbesondere hinsichtlich des Arbeitsschutzes
eine unmittelbare Garantenpflicht.
Unabhängig davon, ob die Beseitigung des Mangels bzw.
des betrieblichen Defizits in ihren Verantwortungsbereich fällt oder nicht,
darf also die Elektrofachkraft bei erkannten Defiziten nicht zulassen,
dass sich die ihr unterstellte elektrotechnisch unterwiesene Person in Gefahr begibt.
Dies bedeutet, dass sie solche Arbeiten nicht zulassen darf,
für deren Durchführung die Werkzeuge (bzw. die PSA) erforderlich sind.
Dieses Beispiel ist ohne weiteres auch auf andere Situationen übertragbar,
z. B. wenn festgestellt wird,
dass Altmaschinen sicherheitsrelevante Mängel aufweisen oder
Mitarbeiter nicht über notwendige Qualifikationen verfügen.
Die Weitermeldung an betriebliche Vorgesetzte oder
die für die Mängelbeseitigung zuständigen betrieblichen Stellen ist
sicherlich richtig und notwendig,
doch entbindet sie nicht von der Verantwortung selbst zu handeln.
Dabei sind zwei Fälle voneinander zu unterscheiden:
- Handeln in unternehmerischer Verantwortung,
um (wie im geschilderten Beispiel) unterstellte Personen zu schützen und - Handeln in Fachverantwortung,
um fachfremde Personen vor Gefahren zu schützen,
die sie selbst nicht erkennen können.
7. Darf ein Hausmeister elektrotechnische Arbeiten durchführen?
Ein Hausmeister darf nur dann
Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln in
eigener Verantwortung durchführen, wenn er die notwendige Ausbildung hierzu besitzt oder
hierzu befähigt ist.
Gemäß § 3 Abs. 1 der DGUV Vorschrift 3 bzw. 4
⇒ siehe Katalog
dürfen elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von einer Elektrofachkraft oder
unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft
unter Einhaltung der elektrotechnischen Regeln errichtet,
geändert oder instand gehalten werden.
Nach § 2 Abs. 3 der DGUV Vorschrift 3 bzw. 4 gilt als Elektrofachkraft,
⇒ siehe Katalog
wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und
Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen
die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und
mögliche Gefahren erkennen kann.
Ein Hausmeister darf Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln
selbstständig nur dann ausführen,
wenn er die Kriterien als Elektrofachkraft erfüllt
(siehe Kap. 3.2.1 „Elektrofachkräfte“).
Die fachliche Qualifikation wird im Regelfall durch den
erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung
(Berufsausbildung, Studium sowie fachliche Weiterbildungen als
Elektrotechniker oder Meister) nachgewiesen.
Es besteht jedoch die Möglichkeit,
Hausmeister ohne elektrotechnische Berufsausbildung zu
„elektrotechnisch unterwiesenen Personen“ (EuP) oder zu
„Elektrofachkräften für festgelegte Tätigkeiten“ (EFKffT) zu qualifizieren
(siehe Kapitel 3.2.3 „Elektrofachkräfte für festgelegte Tätigkeiten“ und
3.2.5 „Elektrotechnisch unterwiesene Person“).
Hausmeister mit einer elektrotechnischen Berufsausbildung,
die jedoch seit längerem keine praktischen Tätigkeiten mehr ausgeführt haben oder
nicht über die Kenntnis des aktuellen Stands der Vorschriften und Regeln verfügen,
müssen entweder zunächst wieder diese Voraussetzungen erfüllen, z. B.
durch den Besuch entsprechender Fortbildungen und
Einarbeitung in die vorgesehenen Tätigkeiten oder
sie sind nur als EuP bzw. EFKffT einzusetzen.
betrachte auch DGUV Vorschrift 3 und
DGUV Vorschrift 4 als Katalog.
8. Muss bei Arbeiten, die nur „unter Aufsicht einer Elektrofachkraft“
durch eine
elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP)
durchgeführt werden dürfen,
eine
Elektrofachkraft permanent anwesend sein?
Nein.
Zwar besagt § 3 Abs. 1 DGUV Vorschrift 3,
⇒ siehe Katalog
dass elektrische Anlagen und Betriebsmittel
nur von einer Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft
errichtet, geändert und instand gehalten werden dürfen,
jedoch konkretisiert die Durchführungsanweisung zu
§ 3 Abs. 1 DGUV Vorschrift 3 den Vorschriftentext wie folgt:
„Die Forderung „unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft“ bedeutet
die Wahrnehmung von Führungs‐ und Fachverantwortung, insbesondere:
- das Überwachen der ordnungsgemäßen Errichtung,
Änderung und Instandhaltung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel - das Anordnen, Durchführen und Kontrollieren der zur
jeweiligen Arbeit erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen
einschließlich des Bereitstellens von Sicherheitseinrichtungen - das Unterrichten elektrotechnisch unterwiesener Personen
- das Unterweisen von elektrotechnischen Laien über
sicherheitsgerechtes Verhalten,
erforderlichenfalls das Einweisen - das Überwachen, erforderlichenfalls das Beaufsichtigen der
Arbeiten und der Arbeitskräfte, z. B.
bei nichtelektrotechnischen Arbeiten in der Nähe
unter Spannung stehender Teile“
wie sie die Fach‐ und Führungsverantwortung ausübt,
d.h. insbesondere, bei welcher der vorgenannten Punkte die
Elektrofachkraft persönlich anwesend ist.
Eine permanente Anwesenheitspflicht („Beaufsichtigen“) besteht nicht zwangsläufig.
Die Elektrofachkraft hat sie zu berücksichtigen,
inwieweit sie ihrer Aufsichtspflicht nachkommt.
Dabei muss sie auch abwägen,
welche Gefahren mit den übertragenen Arbeiten verbunden sind und
ob die ihr unterstellte elektrotechnisch unterwiesene Person in der Lage ist,
die Arbeiten sicher und sachgerecht durchzuführen
(siehe Kap. 2.4.2 „Übertragene Verantwortung der Elektrofachkraft“ und
Kap. 3.2.4 „Elektrotechnisch unterwiesene Person“).
9. Dürfen Arbeiten an elektrischen Anlagen ohne
Benennung eines Anlagen‐ und
Arbeitsverantwortlichen
durchgeführt werden?
Nein.
Jede elektrische Anlage muss gem. DIN VDE 0105‐100 unter
Verantwortung eines
Anlagenverantwortlichen
(siehe Kap. 3.2.2.1 „Anlagenverantwortliche“) betrieben werden.
Der Anlagenverantwortliche muss Elektrofachkraft sein und
hat u. a. sicherzustellen, dass bei
Arbeiten an und in der Nähe der
elektrischen Anlage die besonderen Gefahren,
die von der
Anlage ausgehen, berücksichtigt werden und
ein sicherer Betrieb der Anlage gewährleistet
wird.
Für jede durchzuführende Arbeit muss gem. DIN VDE 0105‐100
ein Arbeitsverantwortlicher
(siehe Kap. 3.2.2.2 „Arbeitsverantwortliche“)
benannt werden,
der die unmittelbare
Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten
an und in der Nähe der elektrischen Anlage
trägt.
Der Arbeitsverantwortliche muss Elektrofachkraft sein.
Arbeits‐ und Anlagenverantwortlicher können ein und dieselbe Person sein.
10. Darf ein Mitarbeiter Leuchtmittel auswechseln?
Gemäß § 3 Abs. 1 der DGUV Vorschrift 3 bzw. 4
⇒ siehe Katalog
dürfen Instandhaltungsarbeiten an
elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln
nur durch eine Elektrofachkraft oder
unter Leitung
und Aufsicht einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Einfache Tätigkeiten mit geringem Gefährdungspotential,
wie z.B. das Auswechseln von
Leuchtmitteln oder
das Wiedereinschalten von Sicherungsautomaten,
können unter
Umständen auch von elektrotechnischen Laien durchgeführt werden,
wenn diese durch die
Elektrofachkraft zur Ausführung dieser Aufgabe
in das sicherheitsgerechte Verhalten ein‐ und
unterwiesen wurden.
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung
ist für diese Fälle zusätzlich
schriftlich festzulegen,
von wem welche Arbeiten unter welchen Voraussetzungen
durchgeführt werden können.
Die Inhalte der Unterweisung sollten im Interesse
aller
Beteiligten schriftlich dokumentiert werden.
Auch sollten die unterwiesenen Personen durch
ihre Unterschrift bestätigen,
dass sie die Inhalte der Unterweisung verstanden haben und
nur
gemäß den gegebenen Anweisungen tätig werden.
11. Ist es notwendig,
einen Betriebselektriker für die Durchführung von Prüfungen nach
§ 14 Betriebssicherheitsverordnung zur befähigten Person zu benennen oder
ist er
Kraft seines Berufes dazu befähigt,
diese Prüfungen durchzuführen?
Ja,
da die Betriebssicherheitsverordnung für die
Verwendung von Arbeitsmitteln im
Allgemeinen gilt und
nicht nur für elektrische Arbeitsmittel.
⇒ siehe Katalog
Aus diesem Grund hat der Arbeitgeber gemäß § 3 Abs. 6 BetrSichV
zu ermitteln und
festzulegen,
welche jeweiligen Voraussetzungen die zur Prüfung befähigten Personen erfüllen
müssen,
die von ihm mit den Prüfungen von Arbeitsmitteln nach den §§ 14, 15 und 16
zu
beauftragen sind.
Insofern hat der Arbeitgeber den Prüfauftrag festzulegen und
Personen zu benennen,
die
aufgrund ihrer Berufsausbildung, Berufserfahrung sowie
ihrer zeitnahen beruflichen Tätigkeit
über die erforderlichen Kenntnisse
zur Prüfung der jeweils vorgesehenen Arbeitsmittel
verfügen.
Die Voraussetzungen zur Befähigung finden sich in
§ 2 Abs. 6 der
Betriebssicherheitsverordnung und
in der TRBS 1203 (siehe Kap. 4.3.2 „TRBS 1203 –
Zur
Prüfung befähigte Personen“ wieder.
⇒ siehe Katalog – TRBS 1203
betrachte dazu auch die
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die
Technische Regeln der Betriebssicherheit (TRBS 1203)
als Katalog.
12. Ist der Elektromeister im Unternehmen automatisch die
verantwortliche
Elektrofachkraft?
Nein,
Die Bestellung zur verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK)
ist dann erforderlich,
wenn der
Unternehmer bzw. seine Führungskräfte nicht Kraft ihrer Position
bereits verantwortliche Elektrofachkräfte sind und
elektrotechnische Fachentscheidungen gem.
Abschnitt 6 der DIN
VDE 1000‐10 selbstständig treffen können.
Ein Elektromeister ist nicht automatisch Kraft seiner Berufsausbildung
verantwortliche
Elektrofachkraft.
Er muss mit dieser Aufgabe ausdrücklich betraut und
zur verantwortlichen
Elektrofachkraft bestellt werden
(siehe Kap. 3.2.2 „Verantwortliche Elektrofachkräfte (VEFK).“
Dabei gehen Fach‐ und Führungsverantwortung für
elektrotechnische Entscheidungen auf ihn
über.
In einer schriftlichen Bestellung sollten daher die
übertragenen Arbeitgeberpflichten,
aber auch Handlungs‐ und Entscheidungsbefugnisse klar definiert werden.
Betrachte hierzu:
DIN VDE 1000-10.
13. Welche Qualifikation wird für die Prüfung
ortsveränderlicher elektrischer
Betriebsmittel benötigt?
Prüfungen elektrischer Arbeitsmittel werden sowohl durch
die Betriebssicherheitsverordnung
als auch durch die DGUV Vorschrift 3 bzw. 4 abgedeckt.
⇒ siehe Katalog – Betriebssicherheitsverordnung
⇒ siehe Katalog – DGUV Vorschrift 3
Beide Vorschriften enthalten auch
Vorgaben bezüglich der Qualifikation
der mit den Prüfungen zu beauftragenden Personen.
Zwar ist die Betriebssicherheitsverordnung als
staatliches Recht vorrangig zu beachten,
doch
bestehen hinsichtlich der Qualifikationsanforderungen an die Prüfer
elektrischer Arbeitsmittel
keine wesentlichen Unterschiede.
Gemäß § 3 Abs. 6 Betriebssicherheitsverordnung
ist es Aufgabe des Arbeitgebers,
die
notwendigen Voraussetzungen für diejenigen Personen
zu ermitteln und festzulegen,
welche
mit der Prüfung oder
Erprobung von Arbeitsmitteln beauftragt werden sollen.
In Abschnitt 3.1 der Technischen Regel für Betriebssicherheit (TRBS) 1203
ist beschrieben,
dass Prüfungen der Maßnahmen zum Schutz vor
elektrische Gefährdungen durch zur Prüfung
befähigte Personen durchzuführen sind,
die über eine
- für die vorgesehene Prüfaufgabe
adäquate technische Berufsausbildung
(eine abgeschlossene elektrotechnische Berufsausbildung,
ein abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik oder
eine vergleichbare, für die vorgesehene Prüfaufgabe
ausreichende elektrotechnische Qualifikation), - mindestens einjährige praktische Berufserfahrung
mit der Errichtung, dem Zusammenbau oder der
Instandhaltung von elektrischen Arbeitsmitteln bzw.
Arbeitsmitteln mit elektrischen Komponenten oder
Anlagen sowie - zeitnahe,
im Zusammenhang mit der Durchführung von Prüfungen stehende berufliche Tätigkeit,
z. B. Reparatur‐, Service‐ und Wartungsarbeiten an
elektrischen Arbeitsmitteln mit anschließender Prüfung sowie
regelmäßige Prüftätigkeit an elektrischen Arbeitsmitteln verfügen.
Für die „zeitnahe berufliche Tätigkeit“ sind
neben der Prüfpraxis auch insbesondere durch
die Teilnahme an Schulungen oder Erfahrungsaustausch
erworbene aktuelle Kenntnisse der Elektrotechnik erforderlich)
Das beschriebene Qualifikationsprofil
deckt sich in Bezug auf die Prüftätigkeit mit den an eine „Elektrofachkraft“
nach der DGUV Vorschrift 3 bzw. 4
⇒ siehe Katalog
gestellten Anforderungen.
Prüfungen nach den DGUV Vorschrift 3 bzw. 4
können durch Elektrofachkräfte oder
im eingeschränkten Maße auch durch
elektrotechnisch unterwiesene Personen durchgeführt werden.
Als Elektrofachkraft im Sinne der DGUV Vorschrift 3 bzw. gilt
gem. § 2 Abs. 3,
wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und
Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen
die ihm übertragenen Aufgaben beurteilen und
mögliche Gefahren erkennen kann.
Im Regelfall wird die fachliche Qualifikation durch
einen erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung, z. B.
als Elektroingenieur,
Elektrotechniker,
Elektromeister,
Elektrogeselle nachgewiesen.
Sie kann aber auch durch eine mehrjährige Tätigkeit
mit Ausbildung in Theorie und Praxis nach
Überprüfung durch eine Elektrofachkraft nachgewiesen werden.
Dieser Nachweis muss dokumentiert werden.
Sollen Mitarbeiter,
die diese Voraussetzungen nicht erfüllen,
für festgelegte Tätigkeiten bei der Inbetriebnahme und Instandhaltung von
elektrischen Betriebsmitteln eingesetzt werden,
können sie durch eine entsprechende Ausbildung eine Qualifikation als
„Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten“ erreichen.
Gemäß der Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 3 der
DGUV Vorschrift 3 bzw. 4 sind
festgelegte Tätigkeiten gleichartige,
sich wiederholende Arbeiten an Betriebsmitteln,
die vom Unternehmer in einer Arbeitsanweisung beschrieben wurden.
In eigener Fachverantwortung dürfen dann nur solche
festgelegten Tätigkeiten von diesen Personen ausgeführt werden,
für die die Ausbildung nachgewiesen ist.
In der Durchführungsanweisung zu § 2 Abs. 3 ist dazu erläutert,
dass die praktische Ausbildung an den infrage kommenden Betriebsmitteln durchgeführt werden muss.
Sie muss die Fertigkeiten vermitteln,
mit denen die in der theoretischen Ausbildung erworbenen Kenntnisse
für die festgelegten Tätigkeiten sicher angewendet werden können.
Die Ausbildungsdauer muss ausreichend bemessen sein.
Je nach Umfang der festgelegten Tätigkeiten kann eine
Ausbildung über mehrere Monate erforderlich sein.
In jedem Fall hat der Unternehmer
im Rahmen seiner Führungsverantwortung zu prüfen,
ob die in der vorstehend genannten Ausbildung erworbenen Kenntnisse und
Fertigkeiten für die festgelegten Tätigkeiten ausreichend sind.
14. Darf ein „frischer“ Elektrikergeselle,
der erst vor kurzem seine Berufsausbildung
abgeschlossen hat,
Prüfungen an elektrischen Betriebsmitteln ausführen?
Gemäß § 3 Abs. 6 der Betriebssicherheitsverordnung ist es
Aufgabe eines jeden Arbeitgebers,
die notwendigen Voraussetzungen zu ermitteln und festzulegen,
welche die Personen erfüllen
müssen,
die mit der Prüfung und Erprobung von Arbeitsmitteln beauftragt werden.
Prüfungen, welche die DGUV Vorschrift 3 betreffen, können von Elektrofachkräften und mit
Einschränkungen auch von
elektrotechnisch unterwiesenen Personen durchgeführt werden.
⇒ siehe Katalog – DGUV Vorschrift 3
⇒ siehe Katalog – Betriebssicherheitsverordnung
Sofern die Prüfungen nach DGUV Vorschrift 3
allerdings auch als Prüfungen i. S. v. § 14
BetrSichV gelten sollen,
muss die Elektrofachkraft auch als
zur Prüfung befähigte Person
beauftragt sein.
Die notwendigen Voraussetzungen für eine Befähigung,
wie z. B. die erforderliche
Berufsausbildung,
Berufserfahrung und
zeitnahe Tätigkeit,
konkretisiert die TRBS 1203
„Zur
Prüfung befähigte Personen“
(siehe Kap. 4.3.2 „TRBS 1203 – Zur Prüfung befähigte
Personen“).
⇒ siehe Katalog – TRBS 1203
Bezogen auf die Berufserfahrung fordert
Abschnitt 3.1 Abs. 2 der TRBS 1203,
dass die zu
befähigende Person für die
Prüfung der Maßnahmen zum Schutz vor elektrischen
Gefährdungen
eine mindestens einjährige praktische Erfahrung
mit der Errichtung,
dem
Zusammenbau oder
der Instandhaltung von elektrischen Arbeitsmitteln bzw.
Arbeitsmitteln
mit elektrischen Komponenten oder
Anlagen besitzen muss.
Es liegt im Ermessen des
Arbeitgebers,
ob bei einem Elektrogesellen mit kürzlich erworbenem Gesellenbrief
davon
ausgegangen werden kann,
dass dieser über seine Berufsausbildung die erforderliche
Berufserfahrung
für befähigte Personen für die Prüfungen im
jeweiligen Tätigkeitsfeld erlangt
hat.
Generell kann bei einer Person,
die die elektrotechnische Berufsausbildung gerade erst
abgeschlossen hat,
unterstellt werden,
dass die erforderlichen Kenntnisse sowie die
erforderliche Berufserfahrung
gem. TRBS 1203 während der Ausbildung vermittelt wurden.
Es
ist allerdings zu empfehlen,
diese durch arbeitsmittel‐ oder prüfspezifische Fortbildungen mit
entsprechenden Fortbildungsnachweisen zu untermauern.
Letztendlich liegt es in der Eigenverantwortung des Arbeitgebers,
zu entscheiden, ob die
Anforderungen an eine
zur Prüfung befähigte Person gem. TRBS 1203 erfüllt sind.
15. Welche Pflichten haben Beschäftigte bei der Benutzung
ortsveränderlicher
elektrischer Arbeitsmittel?
Die Pflichten der Beschäftigten sind in den
§§ 15, 16 ArbSchG geregelt.
Darunter fallen gem.
§ 15 ArbSchG
die bestimmungsgemäße Verwendung der ortsveränderlichen Betriebsmittel
und
die besonderen Unterstützungspflichten gem. § 16 ArbSchG.
Zu den Unterstützungspflichten gehört es,
die elektrischen Arbeitsmittel vor der Benutzung
auf
augenscheinliche Mängel zu prüfen, wie z. B.
mechanische Beschädigungen,
defekte
Anschlussleitungen,
abgelaufene Prüfplaketten etc.
Bei festgestellten Mängeln
ist das
ortsveränderliche elektrische Arbeitsmittel
nicht mehr zu benutzen, und
die Mängel sind dem
Arbeitgeber
(dem zuständigen Vorgesetzten) unverzüglich zu melden.
Es wird empfohlen,
in Form einer Betriebsanweisung den Umgang mit elektrischen
Handwerkzeugen
zu regeln.
16. Welche Qualifikationen muss ein Mitarbeiter haben,
um Sicht‐ und
Funktionsprüfungen elektrischer Betriebsmittel
selbst durchführen zu können?
Gemäß Abschnitt 7 der TRBS 1201
„Prüfungen und Kontrollen von Arbeitsmitteln und
überwachungsbedürftigen Anlagen“
liegt es im Verantwortungsbereich des Arbeitgebers
zu
ermitteln und zu bestimmen,
welche Voraussetzungen die mit der Prüfung beauftragten
Personen erfüllen müssen.
⇒ siehe Katalog – TRBS 1201
Unter Abs. 5 im Abschnitt 7
„Festlegung von Personen, die Prüfungen oder Kontrollen
durchführen“
wird zum Einsatz von unterwiesenen Personen präzisiert:
„Kontrollen von
Arbeitsmitteln nach Nummer 6.4
dürfen die diesbezüglich vom Arbeitgeber
besonders
unterwiesenen Beschäftigten durchführen.“
Entsprechend der Definition im Abschnitt 2.6 der
TRBS 1201 umfassen Kontrollen eines
Arbeitsmittels gem.
§ 4 Abs. 5 BetrSichV
„die Feststellung offensichtlicher Mängel,
die die
sichere Verwendung beeinträchtigen können
(z. B. fehlende Schutzeinrichtung,
nicht
ordnungsgemäße Befestigung,
nicht ordnungsgemäßer Zustand,
fehlende Wirkung von
Schutzmaßnahmen) und
die regelmäßige Kontrolle der Funktionsfähigkeit der
Schutz‐ und
Sicherheitseinrichtungen.
Kontrollen erfolgen ohne oder mit einfachen Hilfsmitteln.“
Der Arbeitgeber hat die notwendigen Voraussetzungen
zu ermitteln und
muss dabei
beachten,
dass bei diesen Kontrollen
- (vom Arbeitsmittel ausgehende) Gefährdungen ohne bzw.
mit einfachen Hilfsmitteln offensichtlich feststellbar sind, - der Soll‐Zustand jedem unterwiesenen Beschäftigten einfach vermittelbar ist,
- der Ist‐Zustand von jedem unterwiesenen Beschäftigten leicht erkennbar ist,
- nur wenige Kontrollschritte erforderlich sind und
- Abweichungen zwischen Ist‐ und Soll‐Zustand
durch unterwiesene Personen einfach bewertbar sind.
ist daher i. d. R. nur auf einfache Sicht‐ oder Funktionsprüfungen eingeschränkt,
die nach Art und Umfang den in TRBS 1201 beschriebenen Kontrollen entsprechen.
Im Vergleich dazu können nach DGUV Vorschrift 3 bzw. 4
⇒ siehe Katalog
elektrische Anlagen und Betriebsmittel durch eine Elektrofachkraft oder
unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft
(z. B durch eine elektrotechnisch unterwiesene Person) geprüft werden.
In Bezug auf elektrotechnisch unterwiesene Personen
bestimmen jedoch letztendlich das individuelle Gefährdungspotenzial und/oder
die sicherheitstechnische Bewertung der betreffenden
Arbeitsmittel und Anlagen,
ob diese ein elektrisches Arbeitsmittel prüfen können und
in welchem Umfang hierbei ggf.
auch eine Aufsicht durch eine Elektrofachkraft
zu erfolgen hat.
17. Welche Qualifikation muss ein Mitarbeiter haben,
um einfache
Instandhaltungsarbeiten an
elektrischen Betriebsmitteln durchführen zu können?
Regelungen hierzu finden sich in § 3 der DGUV Vorschrift 3
⇒ siehe Katalog – DGUV Vorschrift 3
sowie in § 10 Abs. 2 der
Betriebssicherheitsverordnung.
⇒ siehe Katalog – Betriebssicherheitsverordnung
Gemäß § 3 der DGUV Vorschrift 3
„Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“
dürfen elektrische
Anlagen und Betriebsmittel
„nur vor einer Elektrofachkraft oder
unter Leitung und Aufsicht
einer Elektrofachkraft den
elektrotechnischen Regeln entsprechend errichtet,
geändert und
instandgehalten werden“.
Gemäß § 10 Abs. 2 der Betriebssicherheitsverordnung wird bestimmt,
dass die Verwendung
der Arbeitsmittel
(Gebrauch, Instandsetzung, Wartung) nur
„von fachkundigen, beauftragten
und
unterwiesenen Beschäftigten oder
von sonstigen für die Durchführung der
Instandhaltungsarbeiten
geeigneten Auftragnehmern mit vergleichbarer Qualifikation
durchgeführt werden“.
Es ist demnach möglich,
einfache Instandsetzungsarbeiten an elektrischen Betriebsmitteln,
wie
z. B. das Auswechseln von Anschlussleitungen und Kupplungen,
das An‐ und Abklemmen
von Leuchten oder
das Austauschen defekter Schutzverkleidungen an
Lichtschaltern und
Steckdosen etc.,
durch elektrotechnisch unterwiesene Personen durchführen zu lassen.
Die
Ausführung dieser Arbeiten darf allerdings nur
unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft erfolgen.
18. Haben Mitarbeiter im elektrotechnischen Betriebsteil
Anspruch auf einen Zugang zu
geltenden
Verordnungen, Gesetzen, Regelwerken und
kostenpflichtigen Normen?
§ 12 Abs. 1 der Betriebssicherheitsverordnung legt explizit fest,
dass der Arbeitgeber die
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen hat,
damit den Beschäftigten angemessene
Informationen,
insbesondere zu den sie betreffenden Gefahren,
die sich aus den in ihrer
unmittelbaren Arbeitsumgebung
vorhandenen Arbeitsmitteln ergeben
(auch wenn sie diese
Arbeitsmittel nicht selbst benutzen),
in für sie verständlicher Form und Sprache zur Verfügung
stehen.
⇒ siehe Katalog – Betriebssicherheitsverordnung
Dies erfolgt durch Unterweisungen sowie durch zur
Verfügung gestellte Betriebsanweisungen.
Man kann daraus auch ableiten,
dass der Arbeitgeber verpflichtet ist,
den Beschäftigten die
für ihre Tätigkeit entsprechend
notwendigen Informationen und
die dazu benötigten
arbeitsschutzrelevanten
Vorschriften und Regeln zugänglich zu machen.
In Bezug auf den elektrotechnischen Betriebsteil
dürfen mit der Prüfung elektrischer
Arbeitsmittel
beauftragte befähigte Personen Prüfungen nur dann ausführen,
wenn die
Anforderungen an eine zur Prüfung befähigte Person gem. § 1 Abs. 6 der
Betriebssicherheitsverordnung sowie gem.
TRBS 1203 erfüllt sind.
⇒ siehe Katalog – TRBS 1203
Die TRBS 1203 fordert in Abschnitt 2.4 Abs. 2,
dass die zur Prüfung befähigte Person über
Kenntnisse zum Stand der Technik hinsichtlich der sicheren Verwendung des zu prüfenden
Arbeitsmittels und der zu betrachtenden Gefährdungen verfügen und
diese aufrechterhalten muss.
Sie muss mit der Betriebssicherheitsverordnung und
mit weiteren staatlichen
Arbeitsschutzvorschriften
für den betrieblichen Arbeitsschutz
(z. B. ArbSchG, GefStoffV) und
deren
technischen Regelwerken sowie
Vorschriften mit Anforderungen an die
Beschaffenheit
(z. B. ProdSG, einschlägige ProdSV),
mit Regelungen der Unfallversicherungsträger und
anderen Regelungen
(z. B. DIN VDE‐Normen, anerkannte Prüfgrundsätze)
soweit vertraut
sein,
dass sie den sicheren Zustand der Arbeitsmittel beurteilen kann.
Insbesondere muss sie
den
Ist‐Zustand ermitteln,
den Ist‐Zustand mit dem vom Arbeitgeber festgelegten
Soll‐
Zustand vergleichen
sowie die Abweichung des Ist‐Zustands vom
Soll‐Zustand bewerten
können.
Im Umkehrschluss ergibt sich daraus,
dass eine Beauftragung als
zur Prüfung befähigte Person
für Arbeitsmittel
mit elektrischen Komponenten nicht gegeben ist,
wenn der Arbeitgeber
entgegen der Anforderung der TRBS 1203
einer Person,
die er als befähigte Person mit den
Prüfungen beauftragen will,
den Zugang zu den relevanten technischen Regeln und
Normen
im Sinne des
aktuellen Stands der Technik nicht gewährt.
19. Welche Aufgaben dürfen elektrotechnische Laien im Betrieb ausführen?
Elektrotechnischer Laie gem.
DIN VDE 0105‐100:2015‐10 Abschnitt 3.2.6 ist,
wer weder eine
Elektrofachkraft noch eine
elektrotechnisch unterwiesene Person ist.
Elektrotechnische Laien dürfen daher u. a.:
- offensichtlich erkennbare Mängel an Geräten feststellen,
die erkannten Mängel weitermelden und –
sofern keine Gefahr für sie selbst besteht –
mangelhafte Geräte außer Betrieb nehmen, - Lampen, Zubehör (z. B. Starter bei Leuchtstoffröhren) und
Schraubsicherungen bis 63 A auswechseln,
sofern der teilweise Berührungsschutz bei Bedienvorgängen nach
DIN VDE 0100‐600 gegeben ist. - elektrische Geräte anstecken, abstecken, ein‐ und ausschalten,
- elektrische Geräte im spannungslosen Zustand
(entsprechend der Bedienungsanleitung)
äußerlich reinigen, - den FI‐Schalter (= die Fehlerstromschutzschalter‐ Prüftaste) regelmäßig betätigen,
- elektrischen Anlagen im Gefahrenfall (Unfall, Brand, Explosion) abschalten.
- die Spannungsfreiheit prüfen,
- Verlängerungsleitungen reparieren,
- Schalter und Steckdosen reparieren, anschließen oder tauschen,
- Einstellungen an Schutzeinrichtungen (z. B. Auslösewert am Motorschutz) verändern,
- Arbeiten an elektrischen Anlagen verrichten,
- Arbeiten an elektrischen Maschinen,
Geräten und Anlagen
(z. B. Elektroverteiler) verrichten,
die nicht in der Bedienungsanleitung ausdrücklich als für
Laien durchführbar vorgesehen sind.
20. Muss die Qualifikation zur
Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten
regelmäßig
erneuert werden?
Gemäß § 3 Abs. 6 Betriebssicherheitsverordnung
ist es Aufgabe des Arbeitgebers,
die
notwendigen Voraussetzungen für Personen,
welche mit elektrotechnischen Tätigkeiten
beauftragt werden,
zu ermitteln und zu bestimmen.
In Bezug auf die Weiterbildung von
Elektrofachkräften für festgelegte Tätigkeiten für
Prüfaufgaben
können die Konkretisierungen für
zur Prüfung befähigte Personen gem. TRBS
1203
vergleichbar herangezogen werden.
Diese fordert zum Erhalt der Prüfpraxis
⇒ siehe Katalog – Betriebssicherheitsverordnung
⇒ siehe Katalog – TRBS 1203
- eine nachweisbare Prüferfahrung
(z.B. Durchführung von mehreren Prüfungen pro Jahr) und
bei längerer Unterbrechung der Prüftätigkeit eine
Teilnahme an Prüfungen Dritter sowie - die Aktualisierung der Kenntnisse, z. B.
durch die Teilnahme an Schulungen oder
an einem einschlägigen Erfahrungsaustausch.
sind weder in der Betriebssicherheitsverordnung
noch in der konkretisierenden TRBS 1203 vorgegeben.
Anhaltspunkte für eine Aktualisierung der Fachkenntnisse sind
i. d. R. dann gegeben, wenn z. B.:
- die Kenntnisse der Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten
zum Stand der Technik nicht mehr aktuell sind - sich Änderungen in für die Tätigkeiten
relevanten Vorschriften und Regelwerken ergeben haben
fortlaufend zu überprüfen,
ob die Voraussetzungen zur Ausführung der
festgelegten Tätigkeiten durch die von ihm beauftragte
Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten noch gegeben sind.
21. Wann benötigt ein Unternehmen eine Elektrofachkraft?
Die Unfallverhütungsvorschrift
DGUV Vorschrift 3 bzw. 4 regelt in
§ 2 Abs. 3, dass die
Errichtung,
Änderung und
Instandsetzung inkl. der Prüfungen
elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel nur
von einer Elektrofachkraft oder
unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft
durchgeführt werden dürfen.
Demnach muss jedes Unternehmen,
das
elektrische Anlagen und Betriebsmittel betreibt,
errichtet,
ändert und
instand setzt,
dafür
Sorge tragen,
dass die Errichtung,
Änderung,
Instandsetzung und
Prüfung
nur von den in § 3
Abs. 2 aufgeführten Personen,
d. h. einer Elektrofachkraft oder
unter Aufsicht einer
Elektrofachkraft,
durchgeführt werden.
⇒ siehe Katalog
Die Bezeichnung „Elektrofachkraft“
ist allerdings keine Ausbildungs‐ bzw.
Berufsbezeichnung,
sondern ein Qualifikationsstatus,
der nach dem eigentlichen Ausbildungsabschluss erworben
und
in regelmäßigen Abständen durch Weiterbildung aufrechterhalten werden muss.
Als Elektrofachkraft gilt,
wer nach § 3 Abs. 2 DGUV Vorschrift 3 bzw. 4
aufgrund seiner
fachlichen Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen sowie den Kenntnissen
der einschlägigen
Bestimmungen die ihm übertragenen
elektrotechnischen Arbeiten beurteilen und
mögliche
Gefahren erkennen kann.
Im Regelfall fällt hierunter,
wer eine elektrotechnische Berufsausbildung
(z. B. als
Elektroingenieur,
Elektrotechniker,
Elektromeister,
Elektrogeselle etc.) abgeschlossen und
über die zur Ausübung der jeweiligen Tätigkeit notwendigen Kenntnisse und
Erfahrungen
verfügt.
Allerdings ermöglicht es die Durchführungsanweisung zu
§ 2 Abs. 3 DGUV Vorschrift 3
bzw. 4 auch,
zur Beurteilung der fachlichen Ausbildung eine mehrjährige Tätigkeit
auf dem
betreffenden Arbeitsgebiet heranzuziehen.
Die Befähigung eines derart an die Aufgaben
herangeführten Mitarbeiters
ist in Theorie und Praxis durch eine Elektrofachkraft
zu
überprüfen und das Ergebnis der Überprüfung zu dokumentieren.
Gem. § 3 Abs. 6 Betriebssicherheitsverordnung ist es somit
die Pflicht des
Unternehmers/Arbeitgebers,
die notwendigen Voraussetzungen für Personen,
welche mit
elektrotechnischen Aufgaben betraut werden sollen,
zu ermitteln und zu bestimmen.
Zu den
Aufgabengebieten und Qualifikationsanforderungen einer
Elektrofachkraft siehe auch Kap.
3.2.1 „Elektrofachkräfte (EFK)“.
⇒ siehe Katalog – Betriebssicherheitsverordnung
Die Bestellung zur Elektrofachkraft sollte schriftlich dokumentiert werden.
22. Wann benötigt ein Unternehmen eine verantwortliche Elektrofachkraft?
Gem. DIN VDE 1000 Teil 10
müssen elektrotechnische Betriebe oder auch
elektrotechnische
Betriebsteile unter
verantwortlicher Leitung einer Elektrofachkraft stehen.
Somit ist für die
verantwortliche fachliche Leitung eines
elektrotechnischen Betriebs oder Betriebsteils eine
verantwortliche Elektrofachkraft mit der Ausbildung als Techniker,
Meister oder
Ingenieur
sowie
Bachelor oder
Master im Bereich Elektrotechnik sowie
ein zeitnaher Einsatz in diesem
Bereich und
Kenntnisse der aktuellen Normen und Regelwerke erforderlich.
Dies betrifft alle
Unternehmen,
die elektrotechnische Einrichtungen planen,
konstruieren,
errichten,
betreiben,
prüfen oder instand halten.
Verantwortliche Elektrofachkraft ist demnach,
wer gem. DIN VDE 1000 Teil 10
„als
Elektrofachkraft nach Abschnitt 4.2 der Norm
die Fach‐ und Aufsichtsverantwortung
übernimmt und
vom Unternehmer dafür beauftragt ist“.
In allen Fällen,
in denen die verantwortlichen Führungskräfte der in den
Geltungsbereich der
DIN VDE 1000 Teil 10 fallenden Unternehmen
selbst keine Elektrofachkräfte,
sondern
elektrotechnische Laien sind,
dürfen diese keine Fachverantwortung für den Bereich der
Elektrotechnik und Elektrosicherheit übernehmen.
Der Arbeitgeber muss in diesen Fällen die
Leitungs‐ und Aufsichtsaufgaben gem.
DGUV Vorschrift 3 an eine Elektrofachkraft übertragen,
die somit zur verantwortlichen Elektrofachkraft gem.
⇒ siehe Katalog
DIN VDE 1000 Teil 10 wird.
Da es hierbei um die Übertragung von Unternehmerpflichten
im zugewiesenen
elektrotechnischen Rahmen geht,
muss die verantwortliche Elektrofachkraft auf
Grundlage
des § 13 Arbeitsschutzgesetzes,
§ 13 DGUV Vorschrift 1 und
⇒ siehe Katalog – Arbeitsschutzgesetz
⇒ siehe Katalog – DGUV Vorschrift 1
gemäß der DIN VDE 1000‐10 vom
Unternehmer
schriftlich bestellt werden.
23. Wann verliert ein Mitarbeiter seinen
Qualifikationsstatus als Elektrofachkraft?
Gemäß den Erläuterungen zu 5.2 der
DIN VDE 1000‐10 im Anhang A kann
der einmal
erworbene Qualifikationsstatus der Elektrofachkraft
durch mangelnde Fortbildung oder
durch
die Verrichtung
fachfremder Tätigkeiten verloren gehen.
Vor allem, weil der
Stand der Technik und die einschlägigen Normen
ständigen Änderungen
und Neuerungen unterliegen,
bedingt dies eine laufende Fortbildung der mit
elektrotechnischen Tätigkeiten betrauten Personen zur
Auffrischung der bereits erworbenen
Kenntnisse.
§ 7 DGUV Vorschrift 1 verpflichtet den Unternehmer dazu,
⇒ siehe Katalog – DGUV Vorschrift 1
- bei der Übertragung von Aufgaben auf Mitarbeiter
je nach Art der Tätigkeiten zu berücksichtigen,
ob die Mitarbeiter befähigt sind,
die für die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfüllung
zu beachtenden Bestimmungen und
Maßnahmen einzuhalten und - Mitarbeiter,
die erkennbar nicht in der Lage sind,
eine Arbeit ohne Gefahr für sich oder
andere auszuführen,
mit dieser Arbeit nicht zu beschäftigen.
Ausbau der erforderlichen Fachkunde,
welche angesichts der ständigen Änderungen
in den einschlägig zu berücksichtigenden Normenanforderungen
bereits nach einem Jahr ohne Fortbildung gefährdet sein kann.
Vor allem durch mangelnde Fortbildung oder
die längere Ausübung fachfremder Tätigkeiten kann
gem. den Erläuterungen zu 5.2 des Anhang A der
DIN VDE 1000 Teil 10 dazu führen,
dass die einmal erworbene Qualifikation zur
Elektrofachkraft verloren gehen kann.
Welche Qualifikation ein Mitarbeiter
als Elektrofachkraft besitzen muss,
ergibt sich aus § 3 Abs. 2 DGUV Vorschrift 3 bzw. 4.
⇒ siehe Katalog
Als Elektrofachkraft gilt demnach,
wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen
sowie den Kenntnissen der einschlägigen Bestimmungen
die ihm übertragenen elektrotechnischen Arbeiten beurteilen und
mögliche Gefahren erkennen kann.
Die Beurteilung,
ob ein Mitarbeiter über die Qualifikation als Elektrofachkraft verfügt und
ab wann ein Mitarbeiter die Qualifikation nicht mehr besitzt,
liegt alleine beim Unternehmer bzw.
Arbeitgeber bzw.
der von ihm im fachlichen Bereich
beauftragten verantwortlichen Person.
24. Welche Aufgaben dürfen durch
elektrotechnische Laien unter welchen
Voraussetzungen
ausgeführt werden und welche nicht?
Elektrotechnischer Laie ist,
wer weder eine Elektrofachkraft noch eine
elektrotechnisch
unterwiesene Person ist und
gem. DGUV Regel 103‐03 durch eine Elektrofachkraft
über die ihr
übertragenen Aufgaben und
die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten
unterrichtet und
erforderlichenfalls angelernt sowie
über die notwendigen
Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen belehrt wurde.
Grundsätzlich dürfen elektrotechnische Laien
in Unternehmen für elektrotechnische
Aufgaben
eingesetzt werden und
- offensichtliche Mängel an Geräten feststellen,
- Lampen, Zubehör
(z. B. Starter bei Leuchtstoffröhren) und
Schraubsicherungen bis 63A
(NH‐Sicherungen nur unter besonderen Voraussetzungen gemäß EN 50110) tauschen, - elektrische Geräte anstecken, abstecken, ein‐ und ausschalten,
- elektrische Geräte im spannungslosen Zustand (entsprechend der Bedienungsanleitung) reinigen,
- den FI‐Schalter (= die Fehlerstromschutzschalter‐Prüftaste)
regelmäßig betätigen, - abgeschlossene elektrische Betriebsstätten unter
Aufsicht einer unterwiesenen Person betreten, - elektrische Anlagen im Gefahrenfall (Unfall, Brand, Explosion) abschalten.
Sicherheitsregeln für elektrotechnische Laien ausgeführt werden.
Elektrotechnische Laien sind hierin vor
Aufnahme der Tätigkeiten durch eine Elektrofachkraft zu unterweisen.
Keinesfalls dürfen elektrotechnische Laien dagegen
- Schutzabdeckungen an Schaltanlagen bzw. Verteilerkästen
(mit rotem Blitz auf gelbem Hintergrund gekennzeichnete und
verschlossene Abdeckungen) öffnen, - die Spannungsfreiheit prüfen
- Verlängerungsleitungen reparieren,
- Schalter und Steckdosen reparieren,
anschließen oder tauschen, - Einstellungen an Schutzeinrichtungen
(z. B. Auslösewert am Motorschutz) verändern, - Arbeiten an elektrischen Anlagen verrichten,
- Arbeiten an elektrischen Maschinen,
Geräten und Anlagen
(z. B Elektroverteiler) errichten,
die nicht in der Bedienungsanleitung vorgesehen sind, - die Sicherheitsabstände zu Freileitungen unterschreiten.
25. Wie ist die Vertretung einer
Verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK)
in
Abwesenheit zu organisieren?
Die Frage, ob und wie die Vertretung einer
verantwortlichen Elektrofachkraft sichergestellt
werden kann,
ist u. a. davon abhängig, welche Aufgaben und
Verantwortlichkeiten dieser
Elektrofachkraft
konkret übertragen worden sind und
wie sich die betriebliche Situation
gestaltet.
Werden Aufgaben wahrgenommen,
zu deren Umsetzung die fachliche Qualifikation einer
verantwortlichen Elektrofachkraft unbedingt notwendig sind
(z. B. Planung und Auslegung der
elektrischen Neuinstallation eines Gebäudes),
kann diese Aufgabe nicht von Personen
wahrgenommen werden,
die nicht über die Qualifikation einer VEFK verfügen.
Häufig sind die
Rechte zur
Durchführung bestimmter Tätigkeiten auch personengebunden
(z. B. die
Übertragung des Rechts zur
Herstellung von elektrischen Anschlüssen an das
Stromversorgungsnetz
durch den zuständigen Versorgungsnetzbetreiber oder
die Befugnis,
Schalthandlungen in Mittelspannungsschaltanlagen durchführen zu können).
Ist die berechtigte Person zur Durchführung dieser Aufgaben abwesend,
müssen diese
Arbeiten entweder so lange „liegen bleiben“,
bis die VEFK wieder ihre Arbeit aufnimmt oder
es muss eine andere geeignete Person diese Aufgaben wahrnehmen
(z. B. Vergabe des
Planungsauftrags für die elektrische Neuinstallation
an ein externes Ingenieurbüro,
Herstellung des Stromanschlusses durch einen anderen Konzessionsträgers
des
Versorgungsnetzbetreibers oder
durch den Versorgungsnetzbetreiber selbst).
Hieraus kann aber weder ableitet werden,
dass immer eine VEFK präsent sein,
noch dass
grundsätzlich eine VEFK für den Vertretungsfall
„bevorratet“ werden muss.
Dies wäre in den
meisten Fällen
wirtschaftlich auch nicht vertretbar.
In den wenigsten Fällen besteht die Aufgabe einer Führungskraft
in der direkten
Beaufsichtigung der nachgeordneten Beschäftigten.
Der Grundsatz
„Führen kann man nicht
vor Ort“ bedeutet,
dass die Übersicht über alle Tätigkeiten im eigenen
Verantwortungsbereich
schnell verloren geht,
wenn sich die Konzentration zu sehr auf eine Aufgabe
(z. B. die direkte
Beaufsichtigung) fokussiert.
Nur in sehr wenigen Fällen ist eine
direkte Aufsicht
(„Beaufsichtigung“) gefordert.
In Bezug auf eine Vertretungsregelung für eine VEFK,
sind je nach Größe und Struktur eines
Unternehmens
i. d. R. zwei wesentliche Modelle denkbar:
- Das Unternehmen ist groß genug,
dass mehr als eine VEFK beschäftigt wird
(typisch für Industrieunternehmen mit
mehreren Elektrowerkstätten bzw.
Fachabteilungen).
In diesem Fall kann durchaus eine
gleichwertige Vertretung sichergestellt werden. - In dem Unternehmen wird nur eine VEFK beschäftigt.
Solange nicht die eingangs beschriebenen
Verantwortlichkeiten wahrgenommen werden müssen,
kann durchaus auch ein erfahrener Vorarbeiter die
Aufgaben der VEFK im Vertretungsfall wahrnehmen
(z. B. Vergabe von Arbeitsaufträgen an nachgeordnete Elektrofachkräfte,
Einweisung Betriebsfremder in die elektrische Anlage
als Anlagenverantwortlicher).
Kombinationen beider Varianten denkbar.
So könnte z. B. der Vorarbeiter
„einfache“ Entscheidungen im
alltäglichen Arbeitsablauf eigenverantwortlich treffen,
wohingegen für komplexere Aufgaben eine
VEFK des eigenen Unternehmens bzw.
eines externen Dienstleisters zu beauftragen ist.
Da die Option
„liegen lassen bis die VEFK wieder im Dienst ist“
für längere Zeiten der Abwesenheit
keine Option darstellt,
ist grundsätzlich die Schaffung einer
Vertretungsregelung zu empfehlen.
Bezüglich der Bestellung der Vertretung
sind die gleichen Anforderungen zu erfüllen,
wie bei der Bestellung der VEFK selbst, d. h.:
- Nur fachlich und persönlich geeignete Personen dürfen beauftragt werden.
- Die Beauftragung muss „sozialadäquat“ (leistbar) gestaltet sein.
- Die Aufgaben und Befugnisse müssen klar aufgezeigt und
gegenüber anderen Verantwortlichkeiten eindeutig abgegrenzt sein. - Die zur eigenverantwortlichen Durchführung der Aufgaben
notwendigen Mittel
(Geldmittel, Rechte, Befugnisse etc.)
müssen ebenfalls übertragen werden. - Die Beauftragung muss schriftlich erfolgen und
vom Beauftragten gegengezeichnet werden. - Der Beauftragte muss eine Kopie der Beauftragung erhalten.
muss die Beauftragung der Vertretung nicht 1:1
die Aufgaben, Rechte und Befugnisse der VEFK umfassen.
Es ist durchaus möglich,
für die Vertretung die zuvor beschriebene
2. Variante zu wählen,
solange dies im Rahmen der durchzuführenden Aufgaben und
zu treffenden Entscheidungen möglich ist.
Da die im Zusammenhang mit der Erstellung der Bestellungsurkunde
zu diskutierenden Rahmenbedingungen grundsätzlich
mit allen Beteiligten gemeinsam im Vorfeld erläutert werden müssen,
werden diese Fragen somit zwangsläufig geklärt.
26. Gilt die Weisungsfreiheit für
verantwortliche Elektrofachkräfte auch,
wenn diese
begründet nicht
fachgerecht arbeiten?
Die Beauftragung von Elektrofachkräften
obliegt dem Arbeitgeber/Unternehmer.
Hinsichtlich
der Organisation,
Auswahl und Aufsicht hat der Arbeitgeber bzw.
der Unternehmer eine
Führungsverantwortung und
muss prüfen,
ob die Anforderungen durch die Person erfüllt
werden.
Je nach übertragenen Aufgaben und
der Organisationsstruktur des Betriebes tragen
Elektrofachkräfte auch Führungsverantwortung mit
entsprechenden
Entscheidungskompetenzen in Bezug
auf den Betrieb und die Instandsetzung elektrischer
Anlagen und
gelten dann als verantwortliche Elektrofachkräfte
(z.B. als Anlagen‐ oder
Arbeitsverantwortliche).
Gemäß § 7 ArbSchG und § 7
„Befähigung für Tätigkeiten“ der DGUV Vorschrift 1
⇒ siehe Katalog – DGUV Vorschrift 1
muss der
Arbeitgeber
bereits bei der Übertragung der Aufgaben überprüfen,
ob die für die Befähigung
vorgesehenen Personen
in der Lage sind,
die für die Ausführung der übertragenen Aufgaben
zu
beachtenden Bestimmungen und Maßnahmen einzuhalten.
Dabei dürfen Aufgaben
keinesfalls an Personen übertragen werden,
für die sie erkennbar ungeeignet sind.
Besondere Anforderungen an die Befähigung
finden sich zudem in Punkt 2.6 ff. der
DGUV
Regel 100‐001.
Hier wird konkretisiert,
dass die Anforderungen an die Befähigung des
Versicherten
umso höher sind, je größer das Gefährdungspotenzial
der vom Versicherten
auszuführenden Arbeiten ist.
Entsprechend höher sind auch die Anforderungen
an die
Maßnahmen des Unternehmers,
mit denen er die Befähigung der Versicherten zu prüfen hat.
Ergeben sich nach dem Zeitpunkt der Aufgabenübertragung
Zweifel an der Befähigung,
so ist
der Unternehmer gem.
Punkt 2.6 der DGUV Regel 100‐001 angehalten,
eine erneute
Beurteilung vorzunehmen.
Im Ergebnis muss der Arbeitgeber/Unternehmer
bei offensichtlich
nachweisbarer Ausführung
die Arbeiten trotz grundsätzlicher Weisungsfreiheit
einer
verantwortlichen Elektrofachkraft untersagen und
prüfen, ob die Elektrofachkraft für solche
Tätigkeiten in Zukunft
(ggf. mit entsprechender Nachschulung) noch eingesetzt werden kann.
27. Wie muss die Unterweisung eines
elektrotechnischen Laien erfolgen,
damit er als
elektrotechnisch unterwiesene Person
eingesetzt werden kann?
Da Elektrofachkräfte in vielen Betrieben
nicht ständig zur Verfügung stehen,
können für
bestimmte Tätigkeiten
elektrotechnisch unterwiesene Personen eingesetzt werden
(siehe
Kap. 3.2.4 „Elektrotechnisch unterwiesene Personen (EUP)“).
Elektrotechnisch unterwiesene Person ist,
wer durch die mit der Leitungs‐ und
Aufsichtsführung
beauftragte Elektrofachkraft in die ihr übertragenen Aufgaben und
in die
möglichen Gefahren bei
unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und
erforderlichenfalls
angelernt sowie
über die notwendigen Schutzeinrichtungen und
Schutzmaßnahmen belehrt
wurde
(DGUV Information 203‐001).
Die Inhalte der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und
sollten mindestens folgende
Einzelpunkte beinhalten:
- Elektrotechnische Grundlagen (insbesondere Erläuterung der Begriffe Spannung, Strom, Widerstand, Leistung)
- Gefahren des elektrischen Stroms,
- Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen
(insb. die fünf Sicherheitsregeln), - Rechtsgrundlagen, insbesondere Unfallvorschrift
DGUV Vorschrift 3
„Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“
unter Berücksichtigung der zutreffenden VDE Bestimmungen, - praktische Unterweisung in den durchzuführenden Arbeiten,
- Verhalten bei Unfällen,
- Erläuterung des jeweiligen Aufgabengebietes.
den schriftlichen Unterweisungsnachweis
(Theorie und Praxis)
mit der Beauftragung und
einer Arbeitsanweisung gemäß dem
Tätigkeitsprofil zu koppeln.
Denn eine Unterweisung alleine rechtfertigt
die geschulte Person noch nicht
zur Ausführung der Tätigkeiten.
Eine ausdrückliche Bestellung ist zwingend erforderlich.
28. In welchen Abständen muss ein Mitarbeiter zum
Arbeiten unter Spannung an
Fortbildungen zur Ersten Hilfe sowie zum
Training der Herz‐Lungen‐Wiederbelebung
teilnehmen?
Gemäß dem Punkt 3.2.4 der Unfallverhütungsregel
DGUV Regel 103‐03 bzw. ‐04
„Arbeiten
unter Spannung“
ist zum Erhalt der Befähigung zum Arbeiten unter Spannung
eine
Fortbildung in der
Ersten Hilfe und in der
Herz‐Lungen‐Wiederbelebung erforderlich.
Die Maßnahmen zum Arbeits‐ und Gesundheitsschutz müssen
grundsätzlich vom Arbeitgeber
im Rahmen der
Gefährdungsbeurteilung ermittelt und
festgelegt werden.
Als Orientierung
können zusätzlich die bestehenden
berufsgenossenschaftlichen Grundsätze
für betriebliche
Ersthelfer herangezogen werden.
Diesbezügliche Hinweise sind in der
DGUV Information 204‐
022
„Erste Hilfe im Betrieb“ und
DGUV Vorschrift 1
⇒ siehe Katalog – DGUV Vorschrift 1
„Grundsätze der Prävention“ zu finden.
Gemäß § 26 Abs. 3 der DGUV Vorschrift 1
hat der Unternehmer dafür zu sorgen,
dass in
einem Abstand von spätestens zwei Jahren
nach einer vorausgegangenen Teilnahme an
einem Erste‐Hilfe‐Lehrgang oder
‐Training eine entsprechende Fortbildung durchgeführt und
abgeschlossen wird.
Für die Einhaltung der Frist ist der Unternehmer und
fortzubildende
Mitarbeiter verantwortlich.
Zur Teilnahme an Fortbildungen zur
Ersten Hilfe und zur Herz‐
Lungen‐Wiederbelebung
sollte die Zweijahresfrist nicht
selbstverschuldet überschritten
werden.
Betriebliche Organisation und Beauftragung im elektrotechnischen Betriebsteil
1. Was ist unter einer
„wesentlichen Veränderung“ an einer Maschine zu verstehen?
Mit der Novellierung des Produktsicherheitsgesetzes
hat sich der Sinn des Begriffs
„Inverkehrbringen“ wesentlich geändert:
Bisher war unter „Inverkehrbringen“
„jedes Überlassen eines Produktes an einen anderen,
unabhängig davon, ob das Produkt neu,
gebraucht,
wieder aufbereitet oder wesentlich verändert worden ist […]“ zu verstehen.
Nach der neuen Lesart des Produktsicherheitsgesetzes bedeutet nun
„Inverkehrbringen“ nur noch die erstmalige Bereitstellung
eines Produktes auf dem Markt.
Zwar ist damit der bisherige Begriff des „wesentlich veränderten Produktes“ entfallen,
doch ist ein im Vergleich zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme
wesentlich verändertes Produkt nach wie vor
wie ein neues Produkt anzusehen.
Für die Klärung der Frage, ob ein gebrauchtes,
jedoch wesentlich geändertes Produkt als
neues Produkt anzusehen ist,
wurde am 09.04.2015 das Interpretationspapier
„Wesentliche Veränderung von Maschinen“
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)
veröffentlicht.
Im Wesentlichen ist durch eine Gefährdungsbeurteilung festzustellen,
ob die durchgeführten Änderungen entweder zu neuen Gefährdungen führen oder
ob sich dadurch ein bereits gegebenes Risiko erhöht.
Folgende Konstellationen sind denkbar:
- Das Risiko hat sich gegenüber dem vorherigen Zustand nicht erhöht bzw.
es ergibt sich keine neue Gefährdung. - Es ergibt sich zwar ein höheres Risiko oder
eine neue Gefährdung, jedoch sind die vorhandenen Schutzmaßnahmen
nach wie vor ausreichend. - Es ergibt sich ein höheres Risiko bzw.
eine neue Gefährdung,
für die die vorhandenen Schutzmaßnahmen
nicht mehr ausreichen.
dass einer der beiden ersten Fälle vorliegt,
ist keine weitere Schutzmaßnahme erforderlich:
Das Produkt ist als sicher anzusehen und
es liegt somit auch keine wesentliche Veränderung vor.
In der letzten der drei dargestellten Konstellationen
liegt normalerweise ebenfalls keine wesentliche Veränderung vor,
wenn mit einfachen Schutzeinrichtungen das Risiko entweder
völlig eliminiert oder
zumindest ausreichend minimiert wird.
Ist die veränderte Maschine ohne weitere Schutzmaßnahmen
nicht sicher und kann die für den sicheren Betrieb
notwendige Risikominderung nicht mit einfachen Mitteln erreicht werden,
stellt die Veränderung eine wesentliche Veränderung der Maschine dar,
die dann im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes
wie eine neue Maschine zu behandeln ist.
Unter einer einfachen Schutzeinrichtung
im Sinne des Interpretationspapiers können somit
sowohl eine feststehende trennende Schutzeinrichtung
(z. B. Abdeckung einer drehenden Welle)
als auch bewegliche trennende Schutzeinrichtungen
(z. B. Abdeckhauben als Eingriffsschutz)
sowie nichttrennende Schutzeinrichtungen,
die nicht erheblich in die bestehende Sicherheitstechnische Steuerung
der Maschine eingreifen,
verstanden werden.
Letzteres bedeutet,
dass durch diese Schutzeinrichtungen
lediglich Signale verknüpft werden,
auf dessen Verarbeitung die vorhandene Sicherheitssteuerung
bereits ausgelegt ist oder
dass unabhängig von der vorhandenen Sicherheitssteuerung
ausschließlich das sichere Stillsetzen
der gefahrbringenden Maschinenfunktion bewirkt wird
(z.B. Lichtschranken).
Der Austausch von Bauteilen der Maschine
durch identische Bauteile oder
Bauteile mit identischer Funktion und
identischem Sicherheitsniveau sowie
der Einbau von Schutzeinrichtungen,
die zu einer Erhöhung des Sicherheitsniveaus der Maschine führen und
die darüber hinaus keine zusätzlichen Funktionen ermöglichen,
werden üblicherweise nicht
als wesentliche Veränderung angesehen.
Sind die Bedingungen erfüllt,
die eine wesentliche Veränderung einer Maschine begründen,
sind die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes sowie
der neunten Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz
(9. ProdSV, „Maschinenverordnung“)
vollständig zu erfüllen.
Die wesentlich veränderte Maschine muss somit
auch den grundlegenden Anforderungen des Anhang 1
der Maschinenrichtlinie entsprechen.
Für den Anwender bedeutet dies,
dass ein vollständiges Konformitätsbewertungsverfahren
durchgeführt werden muss.
2. Muss ein Arbeitsmittel vor der erstmaligen Verwendung geprüft werden?
Ja,
gemäß § 4 Abs. 5 der Betriebssicherheitsverordnung hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen,
dass Arbeitsmittel vor ihrer jeweiligen Verwendung durch
Inaugenscheinnahme sowie
erforderlichenfalls durch Funktionskontrollen auf offensichtliche Mängel kontrolliert werden
und
Schutz‐ und Sicherheitseinrichtungen einer regelmäßigen Funktionskontrolle unterzogen
werden.
Vor der ersten Verwendung dient diese Prüfung insbesondere dem Feststellen von
Transportschäden.
In manchen Fällen können ergänzend auch messtechnische Prüfungen erforderlich sein, z. B.
wenn der Verdacht besteht, dass bei der Herstellung eines Arbeitsmittels
sicherheitstechnische Aspekte missachtet wurden
(Stichwort: „Gefälschte
Sicherheitszeichen“) oder
äußerlich nicht erkennbare Schäden vorliegen.
3. Müssen elektrische Maschinen und Geräte
für die gewerbliche Nutzung zugelassen
sein,
um in einem Gewerbebetrieb eingesetzt zu werden?
In Bezug auf die Anforderungen an die Bereitstellung und Benutzung der Arbeitsmittel
findet
die Betriebssicherheitsverordnung Anwendung.
Gemäß § 5 BetrSichV darf der Arbeitgeber
„nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und verwenden lassen,
die unter
Berücksichtigung der vorgesehenen Einsatzbedingungen
bei der Verwendung sicher sind.
Die
Arbeitsmittel müssen
- für die Art der auszuführenden Arbeiten geeignet sein,
- den gegebenen Einsatzbedingungen und den vorhersehbaren Beanspruchungen angepasst sein und
- über die erforderlichen sicherheitsrelevanten Ausrüstungen verfügen,
Die bestimmungsgemäße Verwendung schließt ein,
dass der Arbeitgeber dafür Sorge tragen muss,
dass die Arbeitsmittel gemäß den Bestimmungen dieser Verordnung
auch für die Verwendung geeignet sein müssen.
Hier kommt § 9 Abs. 1 Nr. 9 der BetrSichV zum Tragen,
in der festgelegt ist,
dass Arbeitsmittel so bereitzustellen und zu verwenden sind,
dass Gefährdungen für Beschäftigte vermieden werden.
Des Weiteren ist sicherzustellen,
dass Arbeitsmittel
„ausschließlich bestimmungsgemäß entsprechend den Vorgaben des Herstellers verwendet werden“
(§ 7 Abs. 2 BetrSichV).
Sind Haushaltsgeräte nach den Angaben der Hersteller
in der Betriebsanleitung ausdrücklich nicht für gewerbliche Zwecke geeignet,
so dürfen diese in einem Gewerbebetrieb nicht eingesetzt werden.
Finden sich keinerlei Angaben über die gewerbliche Nutzung
von Haushaltsgeräten in den Betriebsanleitungen und
ist die gewerbliche Nutzung durch Herstellerangaben nicht ausgeschlossen worden,
liegt es im Verantwortungsbereich des Arbeitgebers,
gem. § 5 BetrSichV darüber zu entscheiden,
ob diese für den Einsatz im gewerblichen Bereich geeignet sind.
Gegebenenfalls kann zur Klärung auch der Hersteller kontaktiert werden.
4. Dürfen einwandfreie Arbeitsmittel mit abgelaufener Prüffrist
weiter verwendet
werden?
Die Pflicht des Arbeitgebers zur Ermittlung und
Festlegung von Art, Umfang und Fristen von
Prüfungen
im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist in § 3 Abs. 6 BetrSichV verankert.
Zwar sind Überschreitungen der in der TRBS 1201 sowie
der DGUV‐Vorschrift 3 bzw. 4
enthaltenen Prüffristenempfehlungen auf Grundlage der
eigenen Gefährdungsbeurteilung
sowie betrieblicher Erfahrungswerte generell möglich,
allerdings müssen diese das Ergebnis
einer erneuten und dokumentierten
Gefährdungsbeurteilung sein.
Eine nicht begründete und
dokumentierte Prüffristenverlängerung
kann eine Ordnungswidrigkeit oder gar einen
Straftatbestand darstellen.
Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften
zu den Prüfungen des § 5 Abs. 1 bis 3, DGUV
Vorschrift 3 zuwiderhandelt,
handelt gem. § 9 der DGUV Vorschrift 3 im Sinne des
§ 209 Abs.
1 Nr. 1 des SGB VII ordnungswidrig.
Ebenfalls ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 1
des
Arbeitsschutzgesetzes handelt,
wer laut § 22 BetrSichV die Prüfungen gem.
§ 14 BetrSichV
nicht ordnungsgemäß durchführt.
Strafbar gem. § 26 Nr. 2 des Arbeitsschutzgesetzes handelt,
wer durch eine in § 25 Abs. 1
bezeichnete vorsätzliche Handlung
Leben oder Gesundheit eines Beschäftigten gefährdet.
Gefährdungsbeurteilung
1. Muss für jedes elektrische Arbeitsmittel eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden?
Sowohl staatliche Arbeitsschutzvorschriften
(z. B. Arbeitsschutzgesetz,
Betriebssicherheitsverordnung) als auch die
DGUV Vorschrift 1 verpflichten den Arbeitgeber,
durch eine Gefährdungsbeurteilung die für die Beschäftigten
mit ihrer Arbeit verbundenen
Gefährdungen zu ermitteln sowie
die ergriffenen Maßnahmen zur Gefahrenminimierung
auf
ihre Wirksamkeit zu kontrollieren und ggf. anzupassen
(siehe Kap. 5
„Gefährdungsbeurteilungen“).
Dabei muss nicht zwingend jedes einzelne Arbeitsmittel in der
Gefährdungsbeurteilung
aufgeführt werden.
Gehen von gleichartigen elektrischen Betriebsmitteln
gleiche Gefahren
aus, kann es ausreichen, z. B.
Arbeitsmittelgruppen zu bilden,
in der gefährdungsgleiche
Arbeitsmittel zusammengefasst werden.
Die Gefährdungsbeurteilung kann dann für die
Arbeitsmittelgruppe erstellt werden.
2. Muss ein Kleinbetrieb mit drei Mitarbeitern den Aufwand betreiben und eine Gefährdungsbeurteilung erstellen?
Grundsätzlich verpflichtet das Arbeitsschutzgesetz gem.
§ 5 jeden Arbeitgeber, unabhängig
von der Betriebsgröße,
eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen.
D. h., dass auch
Kleinbetriebe mit zehn oder weniger Beschäftigten
zur Durchführung von
Gefährdungsbeurteilungen verpflichtet sind.
Die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung legt
§ 6 des Arbeitsschutzgesetzes fest.
Demnach ist das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung
ab einer Mitarbeiterzahl von mehr als
zehn Beschäftigten oder
nach Anordnung durch die zuständige Behörde schriftlich zu
dokumentieren
(siehe Kap. 5 „Gefährdungsbeurteilung“).
Für Kleinbetriebe mit weniger als 10 Beschäftigten
führt die GDA‐Leitlinie zur
Gefährdungsbeurteilung und
Dokumentation folgendes aus:
Der Arbeitgeber erfüllt die Anforderungen an die
Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung
(§ 6 Arbeitsschutzgesetz) im Sinne des Artikels 9 der
Rahmenrichtlinie 89/391 EWG in kleinen
Betrieben mit
10 oder weniger Beschäftigten, wenn er
- die Gefährdungsbeurteilung mit einer Handlungshilfe durchführt,
die sein Unfallversicherungsträger oder die zuständige staatliche
Arbeitsschutzbehörde zur Verfügung stellt, oder - in Erfüllung seiner Pflichten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und
den dieses Gesetz konkretisierenden Unfallverhütungsvorschriften an der Regelbetreuung teilnimmt und
die ihm von den beratenden Fachkräften für Arbeitssicherheit,
Betriebsärzten oder überbetrieblichen Diensten überlassenen
Unterlagen zur Gefährdungsbeurteilung nutzt, oder - an einem alternativen Betreuungsmodell
(z. B. einem Unternehmermodell) seines
Unfallversicherungsträgers teilnimmt und er die im Rahmen dieses Modells
vorgesehenen Instrumente für die Gefährdungsbeurteilung anwendet.
Eine bestimmte Form ist nicht vorgegeben,
jedoch sollte neben den festgestellten Gefährdungen und
den vorgesehenen Schutzmaßnahmen dokumentiert werden,
wer bis wann die Maßnahmen umsetzt und
wer bis wann die Wirksamkeit der Maßnahmen kontrolliert.
3. Dürfen ermittelte Prüfungen und Prüffristen der Gefährdungsbeurteilung durch Verweis auf eine Datei in digitaler Form hinzugefügt werden?
Ja.
Die Pflicht zur Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung
ergibt sich aus § 6
Arbeitsschutzgesetz sowie
§ 3 Abs. 8 Betriebssicherheitsverordnung.
Demnach müssen je
nach Art der Tätigkeiten und
der Zahl der Beschäftigten die erforderlichen Unterlagen,
aus
denen das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung sowie
die festgelegten Maßnahmen des
Arbeitsschutzes und
das Ergebnis der Überprüfung ersichtlich sind, verfügbar sein.
Die Art und Weise der Verfügbarkeit ist nicht vorgegeben,
d. h., die Speicherung der
Dokumentation auf einem Datenträger
ist möglich und ausreichend
(siehe § 3 Abs. 8 Satz 3
Betriebssicherheitsverordnung).
4. In welchen zeitabständen ist eine Wiederholung, Aktualisierung oder Überarbeitung der Gefährdungsbeurteilung erforderlich?
Gemäß Arbeitsschutzgesetz besteht für den Arbeitgeber
die grundsätzliche Pflicht,
zu
ermitteln und zu bewerten,
ob Gefährdungen für die Sicherheit und die Gesundheit
am
Arbeitsplatz bestehen.
Ferner hat er die Wirksamkeit der aufgrund der
Gefährdungsbeurteilung getroffenen Schutzmaßnahmen zu überprüfen.
Konkretisiert wird die
Forderung der Gefährdungsbeurteilung nach
§ 5 ArbSchG durch die Anforderungen für die
Bereitstellung und
Benutzung von Arbeitsmitteln der Betriebssicherheitsverordnung.
Diese fordert in § 3 Abs. 7 eine regelmäßige Überprüfung der
Gefährdungsbeurteilung unter
Berücksichtigung des Stands der Technik.
Da die Fristen hierfür bisher noch nicht vorgegeben wurden,
sollten sie (analog zu der
Festlegung von Prüffristen für Arbeitsmittel)
entweder gefährdungsorientiert oder
auf Basis
eigener betrieblicher Erfahrungswerte festgelegt werden.
Neben den in regelmäßigen Abständen durchzuführenden Überprüfungen
ist die
Gefährdungsbeurteilung unverzüglich zu aktualisieren, wenn
- sicherheitstechnische Veränderungen der Arbeitsbedingungen einschließlich der Änderung von Arbeitsmitteln dies erfordern,
- neue Informationen (insbesondere Erkenntnisse aus dem Unfallgeschehen oder aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge) vorliegen oder
- die Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 5 BetrSichV ergeben hat, dass die festgelegten Schutzmaßnahmen nicht wirksam oder nicht ausreichend sind.
5. Wer ist für die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen verantwortlich, wenn die Prüfung elektrischer Arbeitsmittel durch Fremdfirmen durchgeführt wird?
Grundsätzlich trägt jeder Arbeitgeber die arbeitsschutzrechtliche Verantwortung für
- die bei ihm beschäftigten Arbeitnehmer gem. § 3 ArbSchG,
- die von ihm bereitgestellten Arbeitsmittel gem. § 5 BetrSichV,
- die genutzten Räumlichkeiten gem. §§ 3a, 4 ArbStättV.
Beim Einsatz von Fremdfirmen teilen sich Auftragnehmer und
Auftraggeber die Arbeitsschutzpflichten.
Entsprechende Vorgaben finden sich sowohl im Arbeitsschutzgesetz
als auch in der BetrSichV und der DGUV Vorschrift 1.
Gemäß § 8 Abs. 1 ArbSchG sind die Arbeitgeber verpflichtet,
bei der Durchführung der
Sicherheits‐ und Gesundheitsschutzbestimmungen zusammenzuarbeiten,
d. h. konkret:
- Soweit dies für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der
Beschäftigten bei der Arbeit erforderlich ist,
liegt es gem. § 8 Abs. 1 ArbSchG je nach
Art der Tätigkeit in der Pflicht beider Arbeitgeber,
sich gegenseitig und ihre Beschäftigten über die mit den
Arbeiten verbundenen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten zu unterrichten und
Maßnahmen zur Verhütung dieser Gefahren abzustimmen. - Der Auftraggeber muss sich gem.
§ 8 Abs. 2 ArbSchG je nach Art der Tätigkeit zudem vergewissern,
dass die Beschäftigten des Auftragnehmers,
die in seinem Betrieb tätig werden,
hinsichtlich der Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit
während ihrer Tätigkeit in seinem Betrieb
angemessene Anweisungen erhalten haben.
In Bezug auf die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
hat der den Auftrag erteilende Unternehmer den
Fremdunternehmer gem. § 5 Abs. 3 DGUV Vorschrift 3
bei der Gefährdungsbeurteilung bezüglich der
betriebsspezifischen Gefahren zu unterstützen.
Außerdem hat der auftragsgebende Unternehmer gemäß § 13 BetrSichV:
- sicherzustellen,
dass Tätigkeiten mit besonderen Gefahren durch
Aufsichtführende überwacht werden,
die die Durchführung der festgelegten Schutzmaßnahmen sicherstellen, - einvernehmlich mit dem Fremdunternehmen zu regeln,
wer den Aufsichtführenden zu stellen hat.
Darüber hinaus trägt grundsätzlich jeder Arbeitgeber
die Verantwortung für die Sicherheit seiner Beschäftigten,
die auch dann nicht aufhört,
wenn diese in Fremdfirmen tätig sind.
Dies betrifft u. a. auch die Bereitstellung und
Benutzung von eigenen Arbeitsmitteln.
Werden Arbeitsmittel für die Ausführung von Aufgaben durch
Beschäftigte beider Arbeitnehmer benutzt,
hat jeder Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen zu Sicherheit und
zum Gesundheitsschutz seiner Beschäftigten gem.
§ 5 BetrSichV zu treffen.
Grundsätzlich haben jedoch die Arbeitgeber
bei der Gefährdungsbeurteilung zusammenzuarbeiten,
um die Sicherheit ihrer Beschäftigten zu gewährleisten.
Prüforganisation im elektrotechnischen Betriebsteil
Dokumentation der Prüfungen
Sicherheitsunterweisungen
Betriebliche Anweisungen
Betrieb elektrischer Anlagen
⇒ siehe Katalog – DGUV Vorschrift 1
Datenschutzeinstellungen
Anschrift
-
Harald Kühn
Am Waldrand 6
16816 Neuruppin